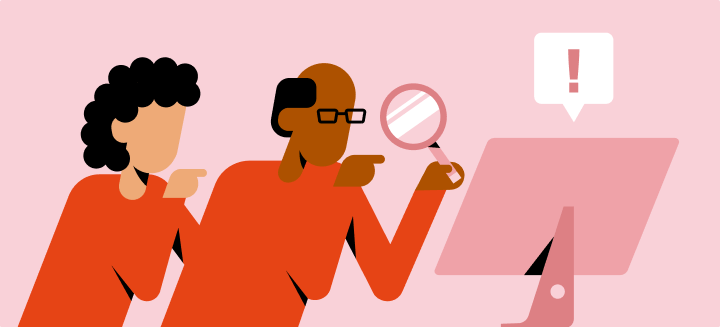Großstadt ohne Größenwahn
In der Besucherordnung des Berliner »Denkmals für die ermordeten Juden Europas« ist eigentlich genau geregelt, mit welcher Gefühlslage hier in den Abgrund der deutschen Geschichte geschaut werden soll: »Das Stelenfeld darf grundsätzlich nur zu Fuß und im Schritttempo durchquert werden.« Lärmen, lautes Rufen und Rauchen sind verboten.
Doch die Jugendlichen, die seit den ersten Frühlingstagen der vergangenen Woche wieder das Denkmal bevölkern, denken nicht daran, hier nur Trauerarbeit zu leisten.
Eine siebte Klasse aus Fürth, soeben noch ergriffen von den Dokumenten im Souterrain des Denkmals, spielte am vergangenen Donnerstag inmitten des Stelenfelds Fangen. Als sich zwei Schüler plötzlich in die Arme fielen, kreischten sie. Später trottete die Klasse in Zweierreihen davon, erschöpft von so viel Vergangenheit - und so viel Gegenwart.
Vielleicht gibt es ja auch im Leben einer Stadt so etwas wie eine Relativitätstheorie. Jedes Ereignis, auch das finsterste, verblasst demnach mit der Zeit. Das Erinnern ist wichtig für die Menschheit, aber das Vergessen womöglich auch. Das neue Berlin ist mehr als nur ein Ort des Gedenkens und Trauerns - fröhlich, frech und manchmal mit dreister Leichtigkeit findet die alte Preußen-Hauptstadt zu einer neuen Identität.
So meldet sich Berlin auf der Bühne der Metropolen zurück und feiert seine Wiederauferstehung als Weltbürgerstadt.
Das neue Berlin hat sich von den traumatischen Erfahrungen der Kriege und Diktaturen so weit befreit, dass niemand mehr auf die Idee kommen kann, hier würde neues Unheil ausgebrütet.
Das neue Berlin hat sich in den übrig gebliebenen Kulissen des alten so selbstverständlich eingerichtet, dass hier auf ziemlich entspannte Weise wieder Staat gemacht werden kann.
Das neue Berlin ist für Deutschland und Europa auch ein Labor der Zukunft.
Die alte West-Berliner Tristesse scheint wie weggeblasen. Der Karnevalsumzug, in der Frontstadt Berlin ein Miniatur-Ereignis, zu dem heimatlose Rheinländer und stadtbekannte Trunkenbolde sich vereinten, lockte in diesem Jahr über eine Million Besucher an, so viele wie früher die Love Parade.
Berlin ist heute eher ein Gemütszustand als eine Örtlichkeit. Das gewollt Coole, auf das New York so stolz ist, gibt es hier nur selten zu bestaunen. Die Londoner Schnöseligkeit fehlt, die Pariser Extravaganz auch, die Enge von Tokio und das Ungeheuerliche und das Angsteinflößende solcher Megastädte wie São Paulo oder Shanghai kann hier erst gar nicht aufkommen.
Berlin ist die wahrscheinlich normalste Haupt- und Millionenstadt der Welt, was wiederum für viele Globetrotter die eigentliche Sensation bedeutet: Der Verkehr fließt, Leib und Leben sind auch um Mitternacht nicht in Gefahr, der Besuch in einem In-Restaurant endet mit einer Rechnung, die in New York oder London kaum für die Vorspeise ausgereicht hätte.
Berlin ist die leiseste und langsamste der Metropolen. Wer hat es schon eilig in einer Stadt, in der jeder zweite Einwohner von Arbeitslosengeld, Rente oder Hartz IV lebt? Woher sollte auch das Getöse kommen, wenn ein Großteil der noch verbliebenen Erwerbstätigen im öffentlichen Sektor sein Auskommen hat? Der typische Berliner ist - rein statistisch gesehen - alt, arm oder öffentlich bedienstet.
Es sind die Künstler, Studenten, Lobbyisten und Politiker, die der Stadt das Großstadtleben einhauchen. Aber es ist eben kein kalter Atem, den sie verströmen. Nichts, was frösteln lässt. Nichts, was Angst verbreitet.
Die Berliner Geruhsamkeit ist nach all den Jahrzehnten der Anspannung und Anmaßung die eigentliche Friedensbotschaft: Völker der Welt, strömt in diese Stadt! Das Schreckliche ist vernarbt, das Schöne kommt wieder durch. Berlin ist heute auch die Hauptstadt des Trostes und der Hoffnung in einer Welt, in der die Unfriedlichen ja keineswegs den Dienst quittiert haben.
Einst wurde in dieser Stadt marschiert, auf Teufel komm raus, links herum und rechts herum. Mauer und Stacheldraht waren die wahren Wahrzeichen, nicht das harmlose Bärchen, das die Stadtflagge schmückt.
Als Zentrale des preußischen Militärstaates ist Berlin groß geworden und bekam die Männer im Waffenrock seither nicht mehr los. Wenn es ein Wort gibt, das die Stadtgeschichte durchzieht, dann ist es dieses: Größenwahn.
Berlin war immer Macht in ihrer rohesten Form. Hier hatten einige der finstersten Figuren der Weltgeschichte ihren Auftritt: Kaiser Wilhelm II. schickte mit Hurra seine Soldaten in den Krieg. Dieser Einfaltspinsel wollte den Deutschen einen »Platz an der Sonne« freischießen, so sagte er zumindest. Der Erste Weltkrieg brachte nichts als Schutt und Schatten.
Adolf Hitler folgte knapp 15 Jahre später. Für sein Streben nach Weltmacht war er bereit, über Millionen Leichen zu gehen. Die Topografie des Terrors hat tiefe Spuren in der Stadt hinterlassen.
In der Wilhelmstraße, da, wo Finanzminister Peer Steinbrück die Staatsschuld verwaltet, residierte einst Hermann Göring. In der Prinz-Albrecht-Straße, gleich um die Ecke, konzipierten die Man-nen um Heinrich Himmler die industrielle Judenvernichtung. Rundherum sollte Germania entstehen, Hitlers Welthauptstadt mit einer Kuppelhalle, in die der Petersdom in Rom 17-mal hineingepasst hätte.
Als hätte das nicht schon für zwei Leben gereicht, ging danach der Ausnahmezustand weiter. Amerikaner, Russen, Briten und Franzosen errichteten ein Besatzungsregime, das Berlin einmal mehr in eine Garnisonsstadt verwandelte.
Alles wurde kompliziert, das Leben, das Reisen und das Arbeiten auch. Die Wirtschaft verließ die umzingelte Enklave. Zurück blieben Muff und Mief, Korruption, Subvention und Eberhard Diepgen, in Ost-Berlin entstand ein Sozialismus der besonders trostlosen Art.
Dieses Berlin ist wie weggeblasen, die Zukunft hat die Stadt ergriffen.
Das macht es so leicht für Menschen aller Kontinente, dazuzugehören. An der Spree wird heute fast jeder im Schnellverfahren eingebürgert. Pariser oder Londoner ist man qua Geburt oder gar nicht. Als New Yorker gilt nur, wer an der Wall Street weit oben oder im Künstlerviertel Soho ganz unten gelandet ist. Wer nicht hip oder wenigstens drogenabhängig ist, darf mit der Aufmerksamkeit seiner Zeitgenossen nicht ernsthaft rechnen.
Die Berliner Toleranz ist da deutlich größer, auch wenn sie, bei Licht besehen, eine besondere Form der Intoleranz ist. Jeder mault gegen jeden. Das Stänkern ist zur zweiten Natur geworden, was die Reiseführer gnädig mit »Berliner Schnauze« umschreiben. Sie wirkt nur deshalb nicht gallig oder gar giftig, weil sich die vielen kleinen Hassereien gegenseitig aufheben.
»Wie kann man hier nicht leben?«, fragt Oskar Melzer, »Es gibt nur diese Stadt.« Clubbesitzer Melzer ist vor zehn Jahren nach Berlin gekommen, sein »Weekend« gibt es seit fast drei Jahren in einem Plattenbau am Alexanderplatz.
Melzers Club hat im vergangenen Jahr den Architekturpreis Berlins erhalten, neben dem Holocaust-Mahnmal und dem Olympia-Stadion. Geschichte in Berlin, das ist ständige Gleichzeitigkeit.
In Melzers Fall ist diese Gleichzeitigkeit durchaus haarsträubend. Sein Großvater Joseph kam in den zwanziger Jahren aus Polen hierher, angezogen vom Gründungsfieber, er verlegte jüdische Literatur und konnte später sich und Teile seiner jüdischen Familie gerade noch vor den Nazis retten. Und nun ist sein Enkel hierher zurückgekehrt.
Melzer hat kürzlich zusätzlich den 15. Stock zum Club ausgebaut, und im Sommer wird das Dach erobert. Unten pocht die Stadt, und hier oben an den Wochenenden, wenn über 1200 Leute durch die Clubräume ziehen, tanzen die Nachkommen der Täter und die Nachkommen der Opfer nach dem gleichen Rhythmus, die Geschichte wird leicht, morgens um drei Uhr, wenn unklar ist, ob der Tag endet oder beginnt.
Es dauert nicht mehr lange, dann übernehmen ohnehin die Politiker die Regie in diesem Metropolenmärchen. Sie vor allem sind es, die der Stadt etwas von jenem Glamour verleihen, den eine Großstadt zur wahren Größe benötigt. Im Berlin dieser Tage wird der bürgerliche Disput gepflegt, allzu schroffe Polemik gilt als unfein und bleibt für die letzten hundert Tage eines Wahlkampfs reserviert. Kein Hass nirgends.
Für Kanzlerin Angela Merkel ist Berlin dabei ein anderer Geschichtsort als für Gerhard Schröder. Ihr Vorgänger sah sich in der Hauptstadt immer wieder an das »Dritte Reich« erinnert. Für Merkel ist Berliner Geschichte vor allem die Geschichte der Teilung, die sie selbst erlebt hat.
Sie lebte einst in der Marienstraße unweit der Mauer. Da waren die Wege Richtung Westen kurz, die Sehnsüchte groß. Die Sehnsüchte haben sich erfüllt für Merkel, weshalb ihre Berliner DDR-Zeit sie gelehrt hat, dass sich Geschichte zum Guten wenden könnte.
In diesen Wochen ist die Strahlkraft Berlins und seiner Kanzlerin noch intensiver als sonst. Deutschland hält die EU-Ratspräsidentschaft und den Vorsitz der G 8, des Verbundes der wichtigsten Industriestaaten der Erde.
Die Präsidentschaft ist wie ein Upgrade für die Hauptstadt. Ein Beamter begann neulich in einem Hintergrundgespräch einen Satz mit: »Solange ich Präsidentschaft bin ...« Man ist jetzt groß in Berlin. Wir sind alle Präsidenten. Man füllt jetzt die riesigen Räume, die auf Wunsch von Helmut Kohl im Regierungsviertel geschaffen wurden, den Kanzleramtsklotz, den Paul-Löbe-Glaspalast. Überall himmelhohe Hallen, gigantische Speicher für Berliner Luft.
Dieses groß wirkende Berlin hat nun endlich auch ein großes Thema: Umwelt, die Rettung der Erde. Seitdem Angela Merkel die EU in verbindliche Umweltziele hineinverhandelt hat, wird in Berlin Weltpolitik gemacht. Sie hat angekündigt, den »Schwung« dieser Entscheidung in die G 8 zu tragen. Berlin als Stadt der Vorreiter.
Aber das war ein kurzer Genuss. Jetzt liegt London vorn. Tony Blair hat angekündigt, dass er Großbritannien ehrgeizigere Umweltziele setzen wird als Merkel der EU. Wird Berlin das auf sich sitzen lassen? Wer wird auf Dauer Weltrettungshauptstadt?
Eigentlich gibt es wenig, was die Gelassenheit und den zarten Stolz der Stadt rechtfertigt. Berlin hat mit Superlativen aufzuwarten, die alles andere als schmeichelhaft sind. Es hat mit der Rütli-Schule im Stadtteil Neukölln die erste Lehranstalt Deutschlands, deren Pädagogen wegen grassierender Gewalt in Klassenzimmern die Selbstauflösung vorgeschlagen haben. In Tegel steht der größte Knast Deutschlands, dessen 1571 Plätze nicht ausreichen für den steten Zustrom von Delinquenten.
Jeder neugeborene Berliner bekommt eine gewaltige Schuldenlast in die Wiege gelegt, es sind 17 700 Euro, mehr als fünfmal so viel, wie einem Baby in München aufgebrummt wird. Die Hauptstadt steht mit 61 Milliarden Euro in der Kreide, es ist eine solch unfassbare Summe, dass kein Berliner Politiker auch nur eine Ahnung davon hat, wie der Schuldenberg jemals abgetragen werden kann.
Aber womöglich verleiht genau das der Stadt diese schnoddrige Gleichgültigkeit, denn wer seine Probleme nicht lösen kann, lernt mit ihnen zu leben, es ist eine Art Fatalismus. Armut ist kein Stigma in Berlin, sie ist der Normalzustand.
Wer in New York lebt oder in Tokio, der gehört statistisch gesehen zur Einkommenselite seines Landes, allein in New York haben 45 Dollar-Milliardäre ihren ersten Wohnsitz, rund um den Central Park liegt das Durchschnittseinkommen bei 70 000 Euro.
Berlin ist die deutsche Hartz-Hauptstadt, wobei zu den Geldempfängern keineswegs nur ehemalige Arbeiter gehören. In wohl keiner anderen deutschen Stadt gibt es ein so großes akademisches Prekariat, das sich Werbeagenturen, Zeitungsredaktionen und Lobbyistenbüros andient, um mit dem Titel Praktikant entlohnt zu werden. Jeder Berliner verfügt im Schnitt über 14 700 Euro im Jahr, das sind gerade mal 7000 Euro mehr als das steuerfreie Existenzminimum.
Die miese Lage sorgt erstaunlicherweise nicht für trübe Stimmung. Vielleicht liegt es daran, dass das Leben fast nirgendwo so billig ist wie an der Spree. Berlin ist die Discount-Hauptstadt der westlichen Welt, die Metropole der Mini-Preise.
130 Euro will die Londoner Subway für ein Monatsticket haben, für die Hälfte des Geldes kann man in Berlin einen Monat lang zwischen Pankow und Wannsee hinund herfahren.
Die Wohnung kostet 450 Euro, 280 mit ungeheizter Toilette, und weil ständig überall neue Clubs und Bars eröffnet werden, gibt es auch laufend irgendwo was umsonst zu trinken. Diejenigen, die es gut mit Berlin meinen, sagen, so habe es auch in New York und London angefangen. Dass Berlin wie New York in den Achtzigern sei, stand neulich sogar in der »New York Times«, und die muss es eigentlich wissen.
Vielleicht liegt die Gelassenheit auch an der veränderten Mischung von Menschen, die diese Stadt bevölkern. 1,7 Millionen Berliner haben die Stadt seit 1991 verlassen, 1,8 Millionen Leute sind hinzugezogen und haben damit für einen regelrechten Bevölkerungsaustausch gesorgt.
Berlin ist dreimal so jung wie Paris und halb so groß wie Tokio, und doch strömen die Neugierigen aus allen Himmelsrichtungen immer weiter hierher, angezogen durch nicht viel mehr als die Idee, dass sich hier Entscheidendes abspielen könnte. Es ist eine Karawane aus Malern, Studenten, reichen Rentnern, Investoren, Lebenskünstlern, die in die Stadt der Theater und Museen aufgebrochen ist.
Berlin macht es Neuankömmlingen einfach. Man braucht nicht viel, um sich zu amüsieren. Ein bisschen Charme, ein wenig Schnauze und ein gutgeschnittenes Hemd. Es gibt keine Absperrketten, die nach Reich und Arm trennen, keine roten Kordeln, die sorgfältig zwischen Akademie und Subkultur, Gesellschaftsadel und C-Sternchen unterscheiden.
Kreativität zieht Kreativität nach sich, es muss am Ende nur eine solche Menge davon geben, die groß genug ist, um Anziehungskräfte zu entfalten. Niemand kann genau sagen, wann Atmosphäre in Wirtschaftskraft umschlägt.
Auf Glamour allein kann man keine Stadt gründen, aber Glamour hilft, der Stadt ein neues wirtschaftliches Unterfutter zu geben. Nirgendwo in Europa gibt es an einem Ort so viele Galerien, um 400 sind es inzwischen, und die in New York, London oder Los Angeles machen hier Dependancen auf. Es gibt etwa 300 unabhängige Modelabel und mehrere Dutzend Film- und Fernsehproduktionsfirmen.
Die Galerie »Neu« von Thilo Wermke und Alexander Schröder liegt im Schatten der Charité, jenseits der Museumsinsel. Die zwei Ausstellungsräume wurden einst als Pferdeställe genutzt, die Tränken sind noch sichtbar.
Die Geschichte von Wermke ist auch die Geschichte des neuen Berlin. Ein Jahr vor Mauerfall floh Wermke über die Grüne Grenze in den Westen, lehrte in Hamburg, doch er ging dann nach Berlin, weil Berlin in Deutschland für ihn die einzige Stadt ist, in der man Kunst machen kann. »Kunst hat zu tun mit Treibenlassen«, und wo geht das besser als in dieser Stadt?
Treibenlassen kann anstrengend sein. Am Abend zuvor war Wermke unter der Spreebrücke an der Friedrichstraße und hat den »Grill Royal« eingeweiht. Aber Wermke ist früh aufgebrochen, bereits gegen zwei. Er hat Familie, er hat die Galerie. Auch das Treibenlassen verlangt Disziplin und die richtige Dosierung.
Die langen Kunstnächte verzaubern heute die Passagen im Scheunenviertel, und im ehemaligen Ost-Berliner Rundfunkturm richten sich derzeit Künstler ihre Ateliers ein. Allein an den Kunstschulen der Stadt sind über 5000 Studenten eingeschrieben. Der Bevölkerungsaustausch der vergangenen Dekade hat der Stadt insgesamt gutgetan, besonders aber der Kunst-Stadt.
Die Wunden der Geschichte erweisen sich in der Gegenwart sogar als Standortvorteil. Berlin ist die Stadt der Kulissen, es hält sie in allen Variationen bereit, hässliche, authentische und vor allem historische. Berlins Karneval der Architekturen reizt die Studiobosse aus aller Welt.
Berlin spielt sich oft selbst, es spielt aber auch andere Städte, Paris oder auch London, wenn es in »80 Tagen um die Welt« gehen soll, und in dem Thriller »Die Bourne Verschwörung« ist es mal Moskau, mal Neapel. Berlin ist eben vielseitig verwendbar.
»Sagen wir es so«, sagte Hollywood-Star Matt Damon, »wir nehmen Berlin für Berlin - und alles östlich davon.« Damon und die anderen Filmstars arbeiten gern hier. Nur in Berlin kann Nathalie Portman so ungestört in Kreuzberger Boutiquen stöbern und George Clooney durch die Clubs der Stadt ziehen, ohne dass eine Fotografentraube ihn bedrängt. Brad Pitt und Angelina Jolie haben sich mittlerweile sogar ein Apartment angeschaut, in der Borsigstraße.
Berlin bleibt cool. Die Stadt selbst fühlt sich als Star und ist angesichts einer Hollywood-Größe noch nicht aus dem Häuschen. »Die Leute in Berlin rasten nicht aus, wenn sie mich auf der Straße erkennen«, sagt Matt Damon.
Die Berliner Wirtschaft profitiert von den Kulissenwechseln. Das futuristische Spektakel »V wie Vendetta« beschäftigte Hunderte und setzte über 17 Millionen Euro um. Insgesamt bringt die Film- und Fernsehbranche pro Jahr etwa eine Milliarde Euro in die Stadt und ihr Umland.
Auch die Politik weiß die Kulissen zu nutzen. Inzwischen hat sich sogar eine ganz spezielle Form des Berlin-Tourismus herauskristallisiert: das Politikergucken. In keiner anderen Hauptstadt kommen sich Bürger und Politiker so nahe wie hier. Der politische Distrikt ist ein Raumschiff geblieben, aber alle haben Zutritt. Gaffen lassen und begafft werden, so lautet das ungeschriebene Gesetz all jener, die den öffentlichen Raum bevölkern.
Zwei Millionen Menschen steigen dem deutschen Parlament jedes Jahr aufs Dach und wandeln durch die gläserne Kuppel hoch über der Stadt. Der Reichstag ist inzwischen der zweitstärkste Touristenmagnet der Republik, nach dem Kölner Dom und weit vor Schloss Neuschwanstein.
Doch neben dieser großen Bühne entstehen wöchentlich neue kleine Bühnen, auf denen Transparenz wenigstens vorgegaukelt wird. Der Eintritt zum Jahrmarkt der Eitelkeiten rund um den Reichstag ist meistens frei.
Auf die Spitze treibt es das Restaurant »Lindenlife« auf dem Boulevard Unter den Linden. Zwischen den Tischen hat man ein Fernsehstudio aufgebaut. Über Boxen überträgt das Restaurant das Streitgespräch der Woche zwischen zwei Politikern direkt nach draußen auf den Bürgersteig.
Den Begafften selbst scheint's zu gefallen. Sie genießen die Öffentlichkeit, die große Bühne der Hauptstadt. Es scheint, als habe die Lebenslust der Stadt, der Hang zum Exhibitionismus, die Sucht nach Vergnügung inzwischen selbst jenes Milieu infiziert, das lange als besonders steif und reserviert galt.
Der Hype um die Hauptstadt macht Politiker zu kleinen Popstars auf der großen Bühne zwischen Alexanderplatz und Reichstag, zwischen Willy-Brandt- und Konrad-Adenauer-Haus. Und deshalb zeigen sie sich auch, wie es Popstars tun: beim Essen, beim Flanieren, gern auch beim Shoppen.
Anders als in der Bonner Republik, wo Helmut Kohl freitags nachmittags in den Hubschrauber nach Oggersheim stieg und das Parlament sich vom Hauptbahnhof aus in alle Richtungen auflöste, kennt die Berliner Republik keine Fünf-Tage-Woche.
Gesundheitsministerin Ulla Schmidt sieht man am Tresen der Gourmetabteilung des KaDeWe oder, wer es wissen will, weiß es: zum anschließenden Abtrainieren der Pfunde im Frauenfitnessclub.
Keiner lebt so demonstrativ öffentlich in Berlin wie Joschka Fischer. Sein »pavianöses Verhalten« (Guido Westerwelle) ist vielerorts zu bestaunen, auch wenn er zwischendurch immer mal wieder in die USA entschwindet.
Besonders imposant war allerdings der Minister Fischer, außen grün und innen eigen. Wenn er von seiner Altbauwohnung in der Tucholskystraße vormittags in Richtung Spree losjoggte, folgten auffällig unauffällig die Sicherheitsbeamten, zu Fuß und per dunkler Limousine.
Die wurde vor allem zum Transport der blauen Wasserflaschen gebraucht, die Fischer bei Bedarf in sich hineinkippte. Ein kleines, für Mitjogger kaum auszumachendes Handzeichen reichte aus, und der Chauffeur setzte zum Überholmanöver an. Das Beeindruckende des Vorgangs lag in seiner stillen Selbstverständlichkeit.
Kohls Mädchen, die heutige Bundeskanzlerin, gibt auf der Berliner Bühne die Bescheidene. Sie wohnt nur zwei Kilometer von ihrem Arbeitszimmer entfernt. Sie taucht zur Verblüffung des Personals zuweilen im »Ullrich«-Supermarkt in der Mohrenstraße auf. Um die Ecke geht Franz Müntefering zu seiner Stammfriseurin, die, wie er bereitwillig berichtet, Nadine heißt.
Eigentlich aber ist die Ecke zwischen Merkels Supermarkt und Münteferings Friseur das Einkaufsrevier von Günter Schabowski,
jenem SED-Politbüro-Mitglied, dessen missverständliche Wortwahl am 9. November 1989 die Mauer öffnete.
Das politische Berlin kann es mit der Nachtclubszene an jedem beliebigen Wochentag aufnehmen. Die Hauptstadt schläft nicht. Und wenn, dann kurz und erst nach mehreren Gute-Nacht-Getränken.
In Groß-, Klein- und Kleinstgruppen, deren einzige Konstante die scheinbar beliebige Kombinierbarkeit der Parteifarben ist, trifft sich ihr Personal am Abend zur Lieblingsbeschäftigung: zum Plauschen, Kungeln, Intrigieren.
Das Leben der meisten ist derart durchpolitisiert, dass sie auf Dinge wie Gemütlichkeit, Diskretion, also den in bürgerlichen Kreisen beliebten Rückzug ins Private, nicht viel geben. Mit ihren bescheidenen Mitteln sind die Politiker der Gegenwart durchaus gewillt, sich der Rastlosigkeit ihrer Umgebung anzupassen. Die Biederkeit lässt mancher Abgeordnete bewusst im Wahlkreis zurück. Schützenfest gibt es dort genug. Und ruhig schlafen kann man daheim im Ehebett sowieso viel besser.
Der Badener CDU/CSU-Fraktionschef Volker Kauder bewohnt in Berlin nur ein Mini-Apartment, das nicht als Lebensraum, sondern allenfalls als eine Art Schlafstation dient. Sein Vize, der Rheinländer Wolfgang Bosbach, bleibt lieber gleich im Hotel. Im Kollegenkreis bekennt er sich fröhlich zu den Vorzügen der Hotelexistenz: »Hier habe ich alles, was ich brauche: Sauna, Rührei, Pay-TV.«
Die Spielplätze des politischen Berlin heißen »Maxwell« und vor allem »Borchardt«. Auf diesen Spielplätzen lässt sich Tag für Tag, Abend für Abend beobachten, wie aus Freunden Feinde werden, aus Feinden Freunde und alle zusammen zu einer politischen Vergnügungsgesellschaft.
Sie bilden eine seltsame Melange aus Nähe und Fremdelei, genießen lässt sie sich an Abenden wie jenen, zu denen »Bild am Sonntag«-Kolumnist Martin Lambeck und der Unternehmensberater Max Müller einladen. Unregelmäßig regelmäßig trifft sich im Keller des Borchardt eine illustre Politiker-, Lobbyisten- und Journalistenschar zu »Wein und Politik«. Es gibt eine Tischrede und eine Erwiderung. Weil der Obergrüne Jürgen Trittin kürzlich verhindert war, sprang mit nur zwei Stunden Vorlauf FDP-Vize Rainer Brüderle ein.
Man kennt sich, man duzt sich, im Zweifel saß man erst am Vorabend bei einem »Hintergrundgespräch« zusammen oder teilte sich denselben Stehtisch beim Sektempfang. Es kommt nicht darauf an, welcher Partei man angehört, es geht auch selten um die Inhalte, wichtig ist, dass man unter dem Deckmantel der Politik zusammenfindet. Sie ist in Runden wie dieser mehr Anlass als Gegenstand.
So ist der eigentliche Star bei »Wein und Politik« auch nicht der Tischredner, sondern der Sommelier. Beim letzten Treffen, das unter dem Motto »Griechenland« firmierte, schenkte er den Teilnehmern gleich zehn verschiedene griechische Weine aus. Statt jeweils den kredenzten Probierschluck zu genießen, leerten einige der Politiker gleich das komplette Glas, was die Aussprache nur noch befeuerte.
So werden die Menschen rund um den Reichstag geprägt von der Stadt, die sie umgibt, und prägen gleichzeitig selbst das Bild ihrer Metropole. In der »New York Times« schwärmte ein Mitarbeiter der Berliner Galerie Max Hetzler jüngst über die deutsche Hauptstadt. Er sagte: »Niemand arbeitet in Berlin, jeder ist entweder ein Künstler oder ein Politiker.«
Es war nicht ironisch gemeint, eher beeindruckt, anerkennend. Seine Feststellung ist die Pointe der neuen Hauptstadt. Sie ist gerade dabei, einen neuen Begriff von Arbeit zu finden, und es scheint, als könnte sie sich daran gewöhnen.
Berlin wimmelt von Industriebrachen, überall in der Stadt stößt man auf Relikte aus einer Zeit, in der noch etwas Handfestes erschaffen wurde, ein Röntgengerät, ein Aktenordner, millionenfach Glühbirnen und Tausende Kraftwerksturbinen. Viele der alten Backsteinfabriken stehen unter Denkmalschutz, sie erinnern an eine Epoche, als es hier noch dampfte und brummte und die Geräusche nicht aus den Boxen der Clubs kamen.
Gerade noch 130 000 Menschen arbeiten in der einst größten Industriestadt Europas im verarbeitenden Gewerbe. 1925 waren es allein in der Metallindustrie 400 000. Der Fall der Mauer brachte Berlin eine weitere Deindustrialisierung. Über 200 000 Industriearbeitsplätze gingen seit der Wende verloren.
Armut kann verschiedene Reaktionen hervorrufen. Sie endet oft in Resignation. Aber sie kann auch Energien freisetzen, sie kann mutig machen, weil es wenig zu verlieren gibt. Es leben zahlreiche Resignierte in Berlin. Es gibt aber auch eine erstaunliche Zahl von Mutigen.
Für viele Bewohner ist die Stadt gezwungenermaßen das deutsche Labor für die Globalisierung. Jedes Zeitalter hat seine eigene Anleitung für den Erfolg, und wie es aussieht, lautet der Leitsatz für die westliche Welt derzeit: Geld wird mit Ideen verdient, oft mit nichts weiter als Ideen.
Wenn er stimmt, dann scheint Berlin gar nicht mal schlecht aufgestellt für die Globalisierung, Stadtteile wie Mitte, Friedrichshain, Kreuzberg und Prenzlauer Berg zumindest. Wenn der Rest der Stadt das Schultheiss-Berlin ist, dann ist das hier das Bionaden- und Latte-macchiato-Berlin.
Hier sitzen ausgewachsene Menschen um die dreißig den ganzen Tag im Café und nennen das, was bislang Frühstück hieß, auf einmal Arbeit. In Berlin wird immer gefrühstückt, um 11 Uhr, um 13 Uhr, um 16 Uhr, es wird also oft gearbeitet. Meist sind es kleine Gruppen, sie haben einen Laptop dabei, sie zeigen sich Texte und Grafiken, sie spielen sich neue Beats oder Melodien vor, sie reden viel über »Projekte« und über »Konzepte«.
Es ist diese Lässigkeit, aus der heraus Ideen für morgen geboren werden, auch wenn das kreative Caféleben in der Gegenwart aus dem Hartz-Programm kofinanziert wird. Viele Ideen werden auf dem Müll landen, bald vergessen sein, aber das macht nichts, solange es genügend Ideen gibt, denen es gelingt, zu überleben.
Marco Köhler hatte so eine Idee. Es ist eine Idee, die gut in diese Stadt passt.
Köhlers Idee heißt »Cruso«, ein GPSgesteuertes Navigationssystem für Touristen. Sie setzen sich Kopfhörer auf und können sich etwas über 200 Berliner Sehenswürdigkeiten erzählen lassen. »Cruso« versorgt Berlin-Besucher mit Erklärungen, es ist der Audioguide für einen Wachstumsmarkt.
Über 6,46 Millionen Gäste kamen im Jahr 2005 zu 14,6 Millionen Übernachtungen in die Stadt. Sie bringen jetzt immer mehr Geld, und Köhler will einen Teil davon für sich einstreichen. Auch als elektronisches Ticket ist das Gerät gedacht, das würde lästige Wartezeiten ersparen, denn nicht wenige Besucher wollen in eines der über 170 Museen der Stadt.
Köhler läuft über das Gelände vor seinem Büro, es ist ein Hightech-Center draußen am Stadtrand, es heißt Adlershof und gilt als einer der modernsten Technologieparks Europas. Rund 1,4 Milliarden Euro sind hier in den letzten anderthalb Jahrzehnten investiert worden. Auf dem Gelände steht eine fünf Meter hohe Stahlplastik, von der Worte aufblitzen: »Träume, Gedanken, Vision«. Es ist eine Art Ortsschild für Adlershof, Berlins Silicon Valley, Berlins Hoffnung.
Kaum jemand hat der einstigen Moser- und Mecker-Stadt, in der das Wort »Berlin-Zulage« zuverlässig die größten Emotionen auslöste, diesen Aufschwung zugetraut. Vor allem nicht die notorischen Berlin-Hasser, die es durch alle Epochen gab. Auch nicht die Berlin-Nörgler, die mit hängenden Schultern auf den Podien der Hauptstadtzeitungen saßen und ihren Pessimismus pflegten. Berlin sei zu forsch, zu derb, zu grob, befand der Feuilletonist Claudius Seidl, die Stadt sei »im Grunde unbewohnbar«.
Berlin hat seit je zum Widerspruch, zur Kritik, gelegentlich eben auch zum Hass gereizt. »Berlin macht auf mich den widrigsten Eindruck: kalt, geschmacklos, massiv. Ich hasse Berlin und die Deutschen schon so, dass ich sie umbringen könnte«, schrieb Rosa Luxemburg an ein befreundetes Paar. Die Wilmersdorfer Bürgerwehr kam ihr zuvor und lieferte sie den Killern der Freikorps aus. Die Kommunistin landete 1919 als Leiche im Landwehrkanal.
Auch Kurt Tucholsky, obwohl Berliner von Geburt an, lebte mit seiner Stadt im Unfrieden. Er vermisste Geist und Großartigkeit. »Der Berliner kann sich nicht unterhalten. Manchmal sieht man zwei Leute miteinander sprechen, aber sie unterhalten sich nicht, sondern sie sprechen nur ihre Monologe gegeneinander«, befand er.
Die ganze Spezies der Stadt behagte ihm nicht: »Der Berliner schnurrt seinen Tag herunter, und wenn's fertig ist, dann ist's Mühe und Arbeit gewesen. Weiter nichts. Man kann siebzig Jahre in dieser Stadt leben, ohne den geringsten Vorteil für seine unsterbliche Seele«, schrieb er in einem Manuskript für das »Berliner Tageblatt«, veröffentlicht im Jahr 1919.
Es ist noch nicht lange her, da wurde die Stadt geschmäht, auch von höchster Stelle. Für Konrad Adenauer, den katholischen Kölner und ersten Kanzler der Bundesrepublik, lag Berlin tief in Deutschlands Osten. Berlin sei, urteilte er, »eine heidnische Stadt«, und ohnehin beginne hinter Magdeburg »die asiatische Steppe«.
Die Vorbehalte sind historisch gut belegt. Berlin war keineswegs auf Avantgardismus abonniert. Wo heute das hippe Großstadtvolk sich herumtreibt, waren zunächst die Tölpel und Taugenichtse zu Hause. Als in Süd- und Westdeutschland schon die Kathedralen in den Himmel wuchsen, erreichte Berlins größtes Gotteshaus eine Höhe von zehn Metern. Die Berliner, so räumt ein selbstkritisches Bonmot ein, »wetzten sich noch den Arsch an der Fichte«, als anderswo schon Handel und Hanse blühten, der Buchdruck (in Mainz) und die Taschenuhr (in Nürnberg) erfunden wurden.
Der Drang nach Nordosten, in die Sümpfe und das Ödland jenseits der Elbe, blieb deshalb jahrhundertelang eher unterentwickelt. Ein paar Zisterziensermönche machten sich im Mittelalter auf, um Gottes Wort unter den heidnischen Slawen, die dort wohnten, zu verbreiten. Urkundlich erwähnt wird Berlin das erste Mal 1244. Die Siedlung lag geduckt am Ufer der Spree und dürfte anfangs kaum mehr als einige hundert Einwohner beherbergt haben.
1411 fiel die karge Region dem schwäbisch-fränkischen Adelsgeschlecht der Hohenzollern zu. Ihr Aufstieg - über den Kurfürsten von Brandenburg und den preußischen König bis zum deutschen Kaiser - war der Aufstieg Berlins.
Sie kombinierten eine rabiate Militärpolitik mit erstaunlicher religiöser Toleranz nach innen. Nach dem Dreißigjährigen Krieg umwarben sie Zuwanderer, ihr Land bot Asyl für französische Hugenotten und böhmische Protestanten. Das zahlte sich aus: Berlin und Brandenburg wurden mit jedem Krieg einflussreicher. Preußen entstand, das Deutsche Reich stieg schließlich zu einem der mächtigsten Staaten Europas auf.
Hier kann jeder »nach seiner Façon selig werden«, versprach der populäre Preußen-König Friedrich II. (1712 bis 1786), die Gottesmänner hielt er kurz, auch der Justiz legte er Zügel an. Ein Todesurteil wegen Sodomie, ergangen gegen einen Kavalleristen, hob er auf: »Der Kerl ist ein Schwein, er soll zur Infanterie.«
Den geborenen Berlinern traute der »Alte Fritz«, wie er im Volksmund genannt wurde, wenig Arbeitseifer zu. Die Professoren hielt er für »Pedanten und faule Bäuche«. Lehrern riet er, sich als Schneidermeister ein Zubrot zu verdienen, denn während der Schulferien mochte er kein Salär zahlen.
Die früh schon aufkeimende Subventionsmentalität in Berlin war Seiner Majestät zuwider: »Die Opernleute sind solche Canaillen-Bagage, dass ich sie tausendmal müde bin«, schrieb Friedrich an den Rand einer Akte. Er wollte die Stadt daher durch Handwerkerfreiheiten, Manufakturansiedlungen und den Zuzug Arbeitswilliger »in Flor« bringen.
Doch der Hang zu den Stellen des Öffentlichen Dienstes erfuhr erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen deutlichen Dämpfer: Berlin entwickelte sich zur Industriemetropole.
Die Industrialisierung blies der Stadt einen stürmischen Atem ein. Werner von Siemens (geboren bei Hannover) begründete in Berlin die Elektrotechnik mit und brachte es innerhalb von 20 Jahren zum Großindustriellen. Zimmermann August Borsig (aus Breslau) ließ ab 1837 immer mehr und immer größere Maschinen und Lokomotiven bauen. Die Banken zog es nach Berlin, auch die Naturwissenschaftler und Erfinder.
Nun schoss frühlingshafter Saft in die Glieder des Gemeinwesens. Im Jahr 1880 überschritt die Einwohnerzahl der Hauptstadt Preußens und des neu gegründeten Reiches die Millionengrenze. Die jüdischen Zuwanderer, oft aus Polen und Galizien, brachten Chuzpe und Intellekt mit, die Emigranten aus den westlichen Regionen meist einen etwas aufsässigen Nonkonformismus, den sie zu Hause nicht ausleben konnten.
»Was heißt Carrière machen anderes, als in Berlin zu leben«, urteilte der Schriftsteller Theodor Fontane (eigentlich ein Apotheker aus Neuruppin), »und was heißt in Berlin leben anderes, als Carrière machen.«
Nach dem Ersten Weltkrieg hatten die Nonkonformisten jeglicher Couleur Oberwasser. Während die politischen Fraktionierungen immer radikaler wurden, Joseph Goebbels (NSDAP) und Ernst Thälmann (KPD) sich ansiedelten, durchlebte Berlin den Taumel der »Goldenen Zwanziger Jahre«. Die Röcke wurden kürzer, die Nächte länger. Das Kabarett blühte, die Prostitution auch, und im Hinterhof sangen die Gören: »Mutta, der Mann mit dem Koks ist da ...« Gemeint war Kokain, damals schon.
Die Besonderheit Berlins waren von jeher die Menschen. In den Zwanzigern lebten und soffen hier einträchtig solche Giganten wie Wladimir Nabokow, Arnold Schönberg und Billy Wilder. Albert Einstein forschte am Kaiser-Wilhelm-Institut, im Café Kranzler saß der Kanzler, und von den Proben an der »Dreigroschenoper« kam Bertolt Brecht herüber. Eine berauschende, abenteuerliche Mischung, mit der es damals keine andere Stadt der Welt aufnehmen konnte.
Zugleich prosperierte in Berlin die solide Basis. In der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wurden in der deutschen Metropole der Tonfilm, das Fernsehen, der Computer, die Thermosflasche, die Atomspaltung und das Perlon erfunden.
Regiert wurde Berlin, seit es Wahlen gab, vornehmlich von Sozialdemokraten. 1912 bekam die SPD bei den Reichstagswahlen 75,3 Prozent der Stimmen - mehr als jemals zuvor und jemals danach.
Als Hitler am 30. Januar 1933 an die Macht kam, tatsächlich Reichskanzler wurde und in der Nacht Tausende Gefolgsleute ihm mit einem Fackelzug huldigten, begann der Weg bergab. Jüdische Berliner wurden zu Unpersonen erklärt, schikaniert, verfolgt, ermordet. Die Künstler verließen die Stadt, manche schon in der ersten Nacht des »Tausendjährigen Reiches«.
Der Umgangston verschärfte sich. Es wurde marschiert statt flaniert, zensiert statt parliert. Alle Aktivitäten, die sich als »entartet«, »bolschewistisch« oder »jüdisch« klassifizieren ließen, wurden verfolgt: Kabaretts, Nachtclubs, abweichende Meinungen. Führer befiehl, wir folgen, hieß die Parole.
Spätestens als die Bomben des Zweiten Weltkriegs die Stadt in Trümmer sinken ließen, galt die Sehnsucht der Berliner nur noch einer kleinen Laube. Die Hoffnung der geschundenen Einwohner richtete sich aufs Überleben. An die Stelle des Größenwahns trat das Kleinkarierte - das nennt man Dialektik.
Der »Kalte Krieg« verschärfte die Situation. Berlin wurde geteilt. Im Osten etablierte sich die »Deutsche Demokratische Republik«, in Wahrheit ein Vasallenstaat der Sowjetunion. In West-Berlin nannte man die DDR »Tätärä« und wurde niemals müde, den SED-Führern die Etiketten »deutsch« und »demokratisch« abzusprechen.
Bis heute sind sich die Berliner nicht einig, ob eine »Revolution« oder eine »Implosion« der DDR den Garaus gemacht hat. Jedenfalls fiel die Berliner Maue,r ohne Blutvergießen, und ein paar Tage lang hatten sich alle Berliner lieb, was sonst nicht ihre Art ist.
Wichtiger als der Ost-West-Gegensatz ist mittlerweile der von Arm und Reich. Zwischen den zwei Berlins klafft ein Graben, der mindestens so tief ist, wie die Mauer hoch war. Berlin, das ist Deutschland-Konzentrat.
Keine 500 Meter von der schicken Welt der Vernissagen, Sushi-Happenings und Luxus-Bohemiens entfernt, mutiert die Stadt unmerklich zu einer Miniatur-Version des Ruhrgebiets. Am nördlichen Ende der Friedrichstraße, im einstmals »roten Wedding«, beginnt Malocher-Land. Kleinbürgerlich bis ins Mark, grundehrlich normal und ungefähr so glamourös wie ein halbvolles Bierglas.
Auf der Müllerstraße reihen sich Wohnblöcke an Pfandleihhäuser und Automaten-Casinos, und kurz vor dem Leopoldplatz steht ein Bauwerk, dessen Architektur die Prekariats-Debatte um ein steinernes Manifest erweitert: 24-Stunden-Tanke im Erdgeschoss, darüber ein Aldi-Markt und Neubau-Apartments.
Anfang der dreißiger Jahre war hier das Aufmarschgebiet der Berliner Kommunisten, berühmt-berüchtigte Kampfzone zahlloser Straßenschlachten »gegen Unrecht und Reaktion«, wie der linke Barde Ernst Busch einst sang.
Heute sind dem Arbeiterbezirk die Arbeiter abhandengekommen. Zwischen billigen Wohnungen und verlassenen Geschäften, die mal »Schuhe zum Verlieben« oder »Moderner Fönfrisör« hießen, erhebt sich das sechsgeschossige Arbeitsamt, als wäre es das neue Wahrzeichen dieses zweiten, des inoffiziellen Berlin.
Die Sachbearbeiter auf den Fluren des brachialen Klinkerbaus verwalten die Schicksale von 35 356 Arbeitslosen - um den Rest kümmern sich die Wirte der umliegenden Kneipen, die das Vakuum in den Köpfen mit Bier auffüllen.
Klischees haben Konjunktur in diesem Milieu; im »Magendoktor« am S-Bahnhof Wedding etwa sind die Barhocker am Boden festgeschraubt - damit hier keiner den Halt verliert. Bis vor kurzem hing eine Liste über dem Tresen, auf der die Namen jener Trinker standen, die gerade Hausverbot hatten.
Der verrucht-abenteuerliche Ruf, den Nord-Berlin schon in den zwanziger Jahren genoss, hat hier die Jahrtausendwende überdauert. Damals riet der Reiseführer »Berlin für Kenner«, sich im Wedding »keiner unbekannten Gesellschaft« anzuschließen und eine Kneipentour durch den Bezirk stets »ohne seine Damen« zu unternehmen.
Einen Weltkrieg, 40 Jahre »Berlin-Zulage« und zwölf Regierende Bürgermeister später ist von der sozialromantischen Milieustudie vor allem die Agonie der Trinker geblieben. In der »Gemütlichen Oldie-Kneipe« spielt die Musikbox »Musst du jetzt grade gehen, Lucille - unsere Kinder sind krank und die Schulden so viel«. Die Stammgäste summen mit. Dialog zwischen zwei Tresenkollegen: »Kummer?« - »Ja.« - »Kenn ich.«
Man braucht keine großen Sprüche in den Weddinger Eckkneipen. Was hier zählt, sind die pünktliche Überweisung des Hartz-IV-Betrags und der nächste Heimsieg von Hertha. Die hippe Glitzer-Hauptstadt liegt aus Berliner Nordwest-Perspektive auf einem anderen Planeten.
Nirgendwo fließen neues und altes Berlin, Geschichte und Gegenwart, Ost-Nostalgie und West-Konsum so ineinander wie am Alexanderplatz. Die Asphaltwüste - Kurzname Alex -, von der keiner genau weiß, wo sie beginnt und wo sie endet, ist die Stein gewordene Diskrepanz zwischen dem hippen Berlin und der Normalität ihrer Ureinwohner.
Menschen wie Brigitte Habraneck gehören zu der Generation von Ost-Berlinern, die sich seit frühester Kindheit am Alexanderplatz trafen und dort in den fünfziger Jahren an einem Automaten für 35 Pfennig ein Keta-Kaviarbrötchen mit einem Zwiebelring zogen. Nun lebt die Rentnerin seit 37 Jahren in ihrer Dreizimmerwohnung in den »Rathauspassagen«, einem langgestreckten Edel-Plattenbau der DDR zwischen Rotem Rathaus und S-Bahnhof mit Blick auf den Alexanderplatz.
Mit ihr zusammen wohnen 1200 Menschen im Gebäude, ein DDR-Dorf unter einem Dach. Fast zwei Drittel der Mieter sind noch »Erstbewohner«. »Der Potsdamer Platz steht für Engstirnigkeit, Kälte und Geld«, sagt Habraneck. »Der Alexanderplatz steht für das Leben.«
Einst war der Alex, so ein VEB Tourist-Reiseführer, »der städtebauliche Mittelpunkt der Hauptstadt der DDR«. Dank Fernsehturm und Weltzeituhr wurde er zum Treffpunkt der ostdeutschen Teil-Nation, den jeder Provinzler der Republik sehen wollte. Wer hier wohnte, der war was.
Auf dem Alex spielte der Osten Westen. Jetzt ist es der ostigste Platz der Hauptstadt. Nirgendwo sonst in der Berliner Innenstadt gibt es so viel DDR auf so wenigen Quadratmetern zu bestaunen.
An den Häuserwänden kleben Plakate, die Wessis zur Heimreise auffordern: »Ostberlin wünscht dir eine gute Heimfahrt - Stuttgart 635 Kilometer«.
Manchmal, wenn es Zeit und Sicherheitsleute zulassen, streift auch der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit über diesen Platz, der nur ein paar hundert Meter entfernt vom Roten Rathaus liegt, dem Dienstsitz des Stadtoberhaupts. Das Amtszimmer des Sozialdemokraten, schlicht und denkmalgeschützt, wirkt so, als würde sein Vorgänger, Eberhard Diepgen (CDU), genannt der »blasse Ebi«, hier noch immer residieren. Nur das knallige Ölgemälde »Drummer und Guitarrist« von Rainer Fetting, das Wowereit ausgesucht hat, signalisiert, dass eine neue Zeit angebrochen ist.
»Berlin, that is the place to be«, sagt Wowereit. »Event« ist eines seiner Lieblingswörter. Und er genießt es, dabei zu sein, der »Regierende Partymeister«, wie ihn die Boulevardblätter tauften: auf den roten Teppichen, die Berlin zu bieten hat, oder beim Treffen der »M4«, der europäischen Metropolenbürgermeister von Berlin, Paris, London und Moskau.
Bei keinem ist der Übergang zwischen Politik und Unterhaltung so fließend wie beim Hedonisten Wowi. »Die Leute«, sagt er, »wollen heute anders angesprochen werden.« Ein bisschen schräg? »Na, klar.« Und übrigens, fügt er kokett hinzu, »gibt es nur wenige Politiker, die man in Unterhaltungssendungen auch präsentieren kann«. Niemand kommt in solchen Augenblicken darauf, dass man einen der Nachfolger Willy Brandts vor sich hat.
Ernsthafte Äußerungen zur Zukunft der Stadt mit ihrem 61-Milliarden-Euro-Schuldenberg gehen ihm nur spärlich über die Lippen. Stattdessen freut er sich, dass drei Zitate von ihm stehende Redewendungen geworden sind: »Ich bin schwul - und das ist auch gut so«, »Sparen, bis es quietscht« und »Arm, aber sexy«.
An eine Reindustriealisierung Berlins glaubt er nicht mehr - aber allzu flapsig lässt er auch Chancen ungenutzt. Ein amerikanischer Investor und die Bahn wollen den Flughafen Tempelhof weiterbetreiben, eine Investition von 350 Millionen Dollar stellte der Mann in Aussicht und versprach Hunderte Arbeitsplätze. Aber als könnte es Berlin sich leisten, winkte Wowereit ab und mokierte sich über den »reichen Onkel aus Amerika«.
Das Rechnen überlässt Wowi seinem Finanzsenator Thilo Sarrazin, der sich in seinem Amtszimmer an der Spree gern vor Grafiken und Tafeln präsentiert. Als er die Berliner Schuldenmalaise übernahm, 2002, sprach er von einem »objektiv rechtswidrigen Haushalt«, neben dem der von Argentinien regelrecht solide sei. Die an den Bau von Bürotürmen ausgereichten Kredite? »Kollektiv-Wahnsinn«. Die Berliner Beamten? »Übelriechend«. Die Kinderbetreuung in der Stadt? »Verwahrung«. Die Finanzkraft? »Zwischen Duisburg und Dortmund«.
Einnahmen von 18 Milliarden Euro stehen Ausgaben von 21 Milliarden Euro gegenüber, und Sarrazin tat, was er konnte. Er strich zusammen, was zusammenzu- streichen war, Beamtenzulagen, Wohnungsbauförderung, Subventionen. Die in den ersten Boom-Hoffnungen nach der Wende aufgelaufenen Schulden kann er damit nicht abtragen. London finanziert ein Großteil des englischen Staatshaushaltes, Berlin hängt am Tropf.
Nach fünf Jahren harter Sparpolitik zog Sarrazin dennoch ein für seine Verhältnisse positives Fazit: »Lassen Sie mich mal so sagen: Der Schutt ist abgeräumt. Wir leben hier nicht mehr im Jahre 1945. Sondern wir leben im Jahre 1947.«
Hat das neue Berlin die große Politik verändert, verbessert sogar? Wird Deutschland heute anders regiert als zu Zeiten der Bonner Republik, die ein Provisorium sein sollte und sich dennoch nur mit einer Mehrheit von 18 Stimmen zum Umzug nach Berlin aufraffen konnte? Was kommt nach der Politik mit Strickjacke?
Waschmaschine nennt die Berliner Schnauze das Kanzleramt wegen der riesigen Bullaugen an den Seiten. Allerdings läuft die politische Wäsche, die hier gewaschen wird, allzu oft ein. Es gibt wohl kaum ein anderes Gebäude in Deutschland, bei dem sich äußerer Anspruch und innere Wirklichkeit so unterscheiden wie beim Kanzleramt. Es ist der Ort, an dem die großen Probleme einer kleinen Lösung zugeführt werden, im permanenten Schleudergang der Großen Koalition. Ihren größten politischen Erfolg, die Klimaziele der EU, erkämpfte Merkel in Brüssel, nicht in Berlin.
Die Kanzlerin ist zu klug, um die Diskrepanz zwischen dem Schein der Stadt und dem Sein ihrer Großen Koalition zu übersehen. Aber sie leidet nicht mehr darunter. Sie hat es sich in den beschränkten politischen Verhältnissen bequem gemacht. Sie versucht, die Entspanntheit der Stadt auf sich zu übertragen.
Die zwanziger Jahre hält Merkel für die lebendigsten aller Berliner Zeiten, sagte sie vor einer Weile. Die hohe »Rotationsgeschwindigkeit« jener Jahre fasziniere sie, das gesellschaftliche Leben damals habe etwas Exzessives gehabt, etwas »An-den-Rand-Gehendes«.
Das heutige Berlin sei politisch stabiler, aber eben auch weniger spannend, merkte sie an: »Vermutlich ist es besser so.«
Berlin ist für Politiker eine verführerische Stadt. Hier wirkt vieles groß, größer jedenfalls als im wahren Leben. Die Worte, die Gesten, die Menschen. Deshalb lieben die Strategen, die sich auf die Vermarktung von Politik verstehen, diese ewig tänzelnde Stadt. Das Oberflächliche, das leicht Glitzernde kommt ihnen entgegen. Es macht Politik schöner, auch hässliche Politik.
LARS-OLAV BEIER, STEFAN BERG,
MARKUS DEGGERICH, MARKUS FELDENKIRCHEN, JAN FLEISCHHAUER, HANS HALTER, MALTE HERWIG, DIRK KURBJUWEIT, PHILIPP OEHMKE, RENÉ PFISTER, DANIEL RETTIG, SVEN RÖBEL, MICHAEL SONTHEIMER, GABOR STEINGART, MORITZ VON USLAR, PETER WENSIERSKI
* Oben: Parade deutscher Truppen nach dem gewonnenen deutsch-französischen Krieg 1871; ausgebombte Lazarettpatienten und Pflegepersonal kampieren im Mai 1945 unter freiem Himmel; unten: am 10. November 1989; Außengastronomie Unter den Linden im Juli 2005. * Beim Berliner Presseball 2003. * Oben: vor dem Alten Museum in Berlin; unten: im April 2006 am selben Ort. * Beim Tag der offenen Tür vor dem Kanzleramt am 27. August 2006.